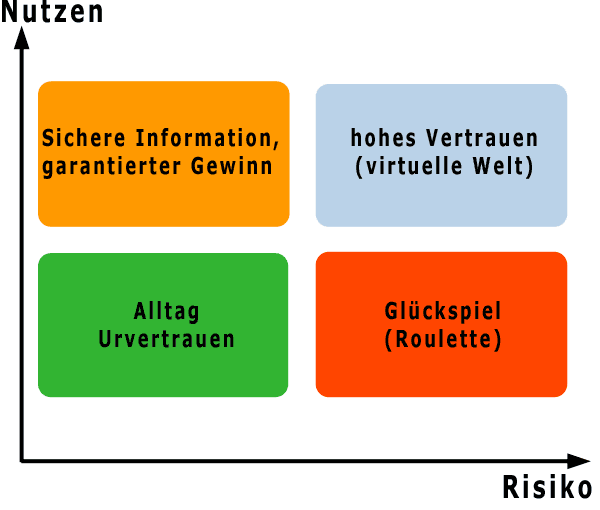Vertrauen in Socialware für multimediale Systeme
Was leistet Vertrauen für die Informationstechnologie?
Vertrauen in Socialware für multimediale Systeme Was leistet Vertrauen für die Informationstechnologie?
In: Herczeg, M; Prinz, W.; Oberquelle, H. (Hrsg.): Mensch und Computer 2002 - Vom interaktiven Werkzeug zu kooperativen Arbeits- und Lernwelten, Berichte des German Chapter of the ACM, Band 56. Hamburg, Germany, September 25, 2002, S. 333-342Dieser Text im Datenformat PDF
Zusammenfassung
Das Thema „Vertrauen in Socialware“ greift Orientierungsdefizite des sozialen Handelns auf, welches sich nicht auf die Glaubwürdigkeit der Medien, sondern auf interaktive Medien als einen Ort realer gesellschaftlicher Komplexität bezieht. Einerseits wirkt sich die Information Richness eines Mediums auf interpersonales Vertrauen aus, andererseits aggregieren soziale Gruppen bzw. strukturale Rollen sich auf Vertrauensstufen, die selbst bei niedriger Informationsmenge tragfähige Entscheidungsgrundlagen anbieten, um individuelle Handlungsrisiken zu kompensieren. Ohne Vertrauen wären multimediale Systeme zwar unterhaltsam sowie konsumierbar, böten aber selten Möglichkeiten, Nutzen bei kalkuliertem Risiko handlungsrelevant werden zu lassen.
1. Ausgangspunkt
Wer Vertrauen vermisst, findet es nicht mittels Suchmaschinen im Internet. Individuen können ihr eigenes Vertrauen nicht passiv erleben, sondern es nur im aktiven Handeln schenken oder erweisen. Sie müssen im Falle ihres Vertrauens bereit sein, das Risiko einzugehen, soziale als auch technische Ausgangsbedingungen und Konsequenzen ihres multimedialen Handelns unvollständig zu überblicken. Könnten sie ihre Informations- und Orientierungsdefizite nicht mittels Vertrauen überwinden, indem sie beispielsweise einer sozialen Organisation vertrauen, wäre der Computer als auch das Internet selten ein Ort, an dem Individuen aktiv handeln und Entscheidungen treffen. Diejenigen, die stoisch misstrauen, handeln nicht. Sie beschaffen Informationen. Setzen sie ihr Vertrauen indessen in eine multimedial vermittelte Sozialinfrastruktur, ermöglichen sie es sich, eine handlungsrelevante „Socialware“ (vgl. Funakoshi. K. et. al. 2001) zu konstituieren. Wie Vertrauen die Socialware der Informationstechnologie fundiert, zeigen folgende Überlegungen.
Ein erster Ausgangspunkt besteht darin, dass unsere Wissensmengen, unsere Archive und unsere sozialen sowie kulturellen Gedächtnisse infolge multimedialer Systeme quantitativ gewachsen sind. Explizites Wissen ist unüberblickbar komplex geworden. Infolge dieser Entwicklung können wir uns als Einzelner nicht mehr überzeugen, ob eine Nachricht der Wahrheit entspricht, ob sie glaubwürdig ist, ob sie einer Logik folgt oder eine Notwendigkeit infolge eines kausalen Geschehens ist. Nicht nur die Komplexität des Wissens hat zugenommen, zudem ist es gleichfalls kontingent, d.h. unser Wissen selbst ist auch anders möglich. Diese Kontingenz des Wissens zieht es nach sich, dass zwischen wahrem/unwahrem, tatsächlichem/fiktionalem, logischem/unlogischem und funktionalem/dysfunktionalem Wissen kontextabhängig zu unterscheiden ist.
Anwender müssen der Funktionalität einer Software beispielsweise in dem Vertrauen begegnen, dass eine installierte Anwendung so reagiert, wie der Hersteller es verspricht. Sie können also einerseits dem Unternehmen vertrauen und darauf hoffen, dass diese „soziale“ Organisation alle Garantieversprechen einhält. Andererseits könnten sie dem Unternehmen misstrauen und darauf vertrauen – wenn sie nicht glauben, der Computer selbst würde alle Schwierigkeiten umgehen – dass ihre soziale Gruppe von informierten Anwendern mögliche Softwareprobleme lösen wird. Vertrauen in Socialware übernimmt hier die Handlungsstrategie, Mißtrauen gegenüber Software oder Unternehmen zu überwinden – Bedienungsanleitungen sowie Garantieerklärungen sichern dann den Fall enttäuschten Vertrauens ab.
Auch in den Wissenschaften, dem Ort wo Wahrheit implizit mit jeder Studie zumindest als Bemühung symbolisch behauptet wird, erkennt der Eingeweihte nahezu nie logische Kohärenz. Infolge ihrer Kontingenz findet der Knowledge Worker im Internet mit genügend Wissen zweiter Ordnung - d.h. mit dem Wissen, wie man Wissen nutzt - für ein spezifisches Thema leicht zwei sich widersprechende Studien. Ebenfalls sind Konsummärkte so strukturiert, dass gleiche Verbrauchsgüter in unterschiedlichsten Berichten voneinander divergierende Ergebnisse erhalten. Und in der Politik sieht es aufgrund ihres Selbstverständnisses nicht anders aus, weil sie sich selten an Wahrheiten, Notwendigkeiten oder Tatsachen orientiert, sondern an mehrheitsfähigen Interessen der Wähler.
Was der informationellen Komplexität und Kontingenz der erwähnten Software, der Politik, des Wissens und den Konsumgüter gemeinsam ist, ist ihre Unübersichtlichkeit und Uneindeutigkeit. Alle vier Bereiche benötigen eine Handlungskompetenz, die ihre kommunikativen Zeichen strukturiert und nach ihrem Orientierungswert beurteilt. Und genau diese kompensatorische Handlungskompetenz wird in Anbetracht der Kommunikation im Internet sowie Usenet deutlich. Sie heißt „Vertrauen“ und meint das soziale Vertrauen darauf, dass ein Mitteilender zuverlässig und objektiv ist, über eine selbsterfahrene Tatsache spricht, sich in seinem Spezialgebiet auskennt oder eben einfach die aktual praktikabelste Orientierung gibt. Die These lautet daher: Akteure reduzieren die informationelle Komplexität und Kontingenz der multimedialen Systeme durch Vertrauen. Vertrauen ist nicht nur eine Orientierungsweise im Alltag, sondern eine notwendige Socialware, die multimediale Systeme als einen virtuellen Handlungsraum absichert. Ohne dieses Vertrauen als Socialware ließe sich allenfalls der Unterhaltungswert der Computertechnologie erleben, aber keine handlungspraktische Relevanz für beispielsweise das Berufsleben aufzeigen.
2. Wozu Vertrauen?
Wie entstehen multimedial vermittelte Situationen des Vertrauens? Vertrauen variiert zwar mit den Handlungsbezügen, in denen es erbracht wird, aber in seinen Charakteristika bleibt es homogen. Eine Situation, wäre beispielsweise folgende: Eine Person möchte sich ein Auto kaufen. Sie erwartet, dass sie die informativsten und vertrauenswürdigsten Verbraucherberichte in Autonewsgroups findet. Von Newsgroups im Usenet nimmt sie an, dass dort keine Informanten schreiben, die ein kommerzielles Marketinginteressen vertreten, sondern so aufrichtig wie möglich über ihr Auto berichten. Die Person kauft schließlich ein spezifisches Auto, weil sie mehreren Mails vertraut, die die Haltbarkeit des Fahrzeugs loben. Insofern ist der Autokäufer ein vorangegangenes soziales Engagement eingegangen: Er hat infolge der Verbraucherberichte das Auto gekauft und vertraut darauf, dass sich die positiven Praxisberichte als zutreffend erweisen. Er erwartet also, dass die alltagserfahrenen Fahrer besser die Informationen über das Auto einschätzen können als er selbst. Erst ab dem Zeitpunkt, ab dem er der Empfehlung folgt, fällt er seine Entscheidung im Vertrauen darauf, dass alltagserfahrene Fahrer besser die Informationen über das Auto einschätzen können als er selbst. Auf diese Weise reduziert Vertrauen die Komplexität der potentiell möglichen und entscheidungsrelevanten Informationen. Zudem verdeutlichen Newsgroups, wie Vertrauen als Socialware hinsichtlich der kooperativen Filterung von Informationen fungiert.
a. Vertrauen erbringt Orientierung
Vertrauen erbringt mehre Vorteile im Handeln. Zunächst ist die individuelle Orientierung zu nennen. Wer vertraut, der erwartet, dass andere das wissen, was er selbst nicht weiß. Er reduziert unsichere und mehrdeutige Informationen, indem er einer sozialen Gruppe oder Institution vertraut. Auf diese Weise erlangt er trotz seiner Unsicherheiten ad hoc Orientierung in der multimedialen Wissensgesellschaft. In diesem Vertrauen überspringen Individuen ihr eigenes Informationsdefizit, um trotzdem zu handeln und zu entscheiden. Vertrauen ist demnach eine sozial orientierte Strategie, angenommenen oder tatsächlichen Informationsmangel zu kompensieren.
b. Vertrauen beschleunigt Orientierung
Wer einer Information misstraut, bemüht sich, sein Informationsdefizit auszugleichen. Er verliert Zeit, sobald er eigene und damit möglicherweise eindeutige Informationen erhalten möchte, um nicht vertrauen zu müssen. Erbrachtes Vertrauen versucht, einen Zeitverlust zu minimieren. So umgehen Individuen mittels Vertrauen einerseits ihr angenommenes Informationsdefizit, und wirken andererseits dem potentiellen Zeitverlust bei ihrer Entscheidungsfindung entgegen. In einer Terminologie der Geschwindigkeiten beschrieben, lässt sich annehmen, dass Vertrauen praktisches Handeln von Individuen beschleunigt, indessen Mißtrauen sowie Unvertrauen es verlangsamt. Vertrauen beschleunigt somit individuelle Handlungsorientierung.
c. Vertrauen macht Zukunft sicher
Der dritte Aspekt des Vertrauens zeigt sich darin, dass jemand, der vertraut, Zukunft vorweg nimmt. „Er handelt so, also ob er der Zukunft sicher wäre.“ (Luhmann 2000, 9) Individuen erzielen diese Handlungssicherheit, indem sie davon ausgehen, das jemand anderes dafür sorgt, dass das Handlungsziel so eintreten wird, wie sie es selbst erwarten. Diese infolge des Vertrauens angenommene Handlungssicherheit verdeutlicht den vierten Aspekt.
d. Handeln im riskierten Vertrauen
Jemanden zu vertrauen impliziert notwendig, das Risiko auf sich zu nehmen, die Zukunft unzutreffend erwartet zu haben. Beispielsweise tritt das erwartete Handlungsziel nicht ein, weil ein mit Vertrauen bedachtes Mitglied einer Internet Community unzureichend informiert war. Vertrauensverlust oder gar Mißtrauen gegenüber diesem virtuellen Mitglied tritt dann vermutlich zügig ein und ist nur durch besondere Zusatzleistungen auszugleichen, um die aufgezeigten Vorzüge des Vertrauens als Socialware zu nutzen. Vertrauen ist grundsätzlich an das Risiko gebunden, falsch zu handeln bzw. eine unrichtige Entscheidung zu treffen.
Beispielsweise läßt sich im Ecommerce eine Kundenzufriedenheit und Kundenbindung kaum erzielen, sobald Kompetenz und Zuverlässigkeit des Anbieters in Frage steht. Abbildung 1 veranschaulicht schematisch, wie bei als unsicher geltenden Geschäften im Internet ein hohes Vertrauen mit dem Risikokalkül des zu erwartenden Nutzens verbunden sein kann. Sofern ökonomisches Handeln erforderlich ist, bezieht sich Vertrauen auf die Relation von Nutzen und Risiko
.
e. Vertrauen impliziert Handeln
Der Aspekt des Risikos verdeutlicht, dass Vertrauen an Handeln gebunden ist. Ein Konsument erlebt beispielsweise den Sinn eines Artikels, einer Fernsehsendung oder einer Website, trotzdem ist es für ihn unnötig, den Beiträgen zu vertrauen. Vertrauen unter dem notwendig implizierten Risiko muss jemand erst fassen, wenn er eine handlungsrelevante Entscheidung trifft. Er benötigt beispielsweise eine verlässliche Information für ein technisches, soziales oder psychisches Problem, welches er durch sein eigenes Handeln bearbeitet. Erst in diesem risikobereiten Handeln zeigt sich der Akteur als ein vertrauender.
Abbildung 1: Nutzen versus Risiko (nach: Frank Reese)
Jeder Akteur im Internet vertraut erst dann einem sozialen Kontakt, wenn er sein Handeln auf diesen bezieht. Ohne diesen spezifischen sozialen Handlungsbezug gehen Akteure weder Vertrauensbeziehungen noch Risiken ein. Ausschließlicher Konsum von Push Medien erlebt man risikolos, solange kein Handeln erfolgt. Um Medien zu erleben, ist soziales Handeln unnötig.
Vertrauen ist in multimedialen Systemen keineswegs „blindes Vertrauen“, sondern stets ein riskiertes. Akteure bemühen sich mit dem Einsatz des Vertrauens, innerhalb der multimediale Systeme eine soziale Ordnung zu stabilisieren und zu sichern (vgl. Misztal 1996, 11). Auf diese Weise kompensieren sie den alltäglichen Informationsreichtum, den sie bei körperlicher Kopräsenz der Interaktionspartner kennengelernt haben. Denn die Face-To-Face Kommunikation bietet wesentlich mehr informative Anzeichen als die Kommunikation per E-Mail, dass jemand z.B. zuverlässig ist. Je nachdem, welche qualitativen und quantitativen Informationen gegenüber dem „Gegenstand“ des Vertrauens zu erreichen sind, bilden sich spezifische Strukturen und Zeichen des Vertrauens aus. Wie sich diese Ausprägungsformen hinsichtlich multimedialer Systeme entwickelt haben, möchte ich zunächst darlegen. Im Anschluss daran möchte ich darlegen, warum bidirektionale Kommunikationsmedien Vertrauen benötigen, indessen unidirektionale Kommunikationsmedien mit der wesentlich risikoärmeren Einschätzung der Glaubwürdigkeit auskommen.
3. Vertrauen in multimedialen und interaktiven Systemen
Die meisten Sicherheitstechniken, die die Computerindustrie entwickelt, prägt Misstrauen gegenüber der Technik oder der (Welt-)Gesellschaft. Selbst das Internet war ursprünglich eine Erfindung des Misstrauens gegenüber zentraler Steuerungsgewalt und Kontrolle (vgl. Bechter 2001, 128). Das amerikanische Militär wollte eine technische Infrastruktur, deren Vernichtungssicherheit in der Vermeidung einer leicht verwundbaren Hierarchie lag. Kommunikation sollte in alle Richtungen auch dann noch möglich sein, wenn einzelne Knotenpunkte ausfielen. Bereits in diesem Merkmal der in sich vernetzten Infrastruktur unterscheidet sich das Internet von den klassischen unidirektionalen Medien wie z.B. Fernsehen, Radio und Zeitungen. Das Internet erlangte das Vertrauen des Militärs, weil es infolge seiner Struktur ein Befehlsmonopol verunmöglichte. In gleicher Struktur genießt das Internet bei privaten Anwendern heutzutage Vertrauen: es verhindert sowohl hierarchische Wahrheits- als auch Meinungsmonopole durch eine zumindest egalitär geplante Struktur. Die Industrie sowie die Gesetzgebung mißtraut indessen der herrschaftsimmunen Internetstruktur, indem sie ihr Informationsdefizit hinsichtlich der Sozialstrukturen mit illegaler Handlungen anmeldet, wie z.B. Raubkopien, Kinderpornographie, politische Ansichten.
Unidirektional hierarchische Medien sind nicht nur sehr verletzlich, sondern sie ermöglichen zudem keine interaktive Kommunikation. In multimedialen Systemen liegt eine soziale Interaktion im soziologischen Sinne dann vor, wenn mindestens zwei Individuen zueinander in wechselseitige Beziehung treten können und im Rollentausch Mitteilender als auch Adressat sein können (vgl. Maletzke 1998, 43). Klassische unidirektionale Medien bieten diese Form der Interaktion nur bedingt, weshalb sie Vertrauen selten beanspruchen. Bidirektionale Medien setzen indessen häufiger (interpersonales) Vertrauen voraus, weil sie dem Nutzer ein interaktives, als auch soziales Handeln ermöglichen und abverlangen.
3.1. Information Richness und interpersonales Vertrauen
Alltäglicherweise entsteht das interpersonale Vertrauen in der lebensweltlichen Kommunikationssituation des Face-To-Face. In dieser Situation bezieht es sich sowohl auf ein kopräsentes Gegenüber als auch auf soziale Identität (vgl. Sztompka 1999, 41). Interaktive Systeme bieten eine veränderte, medial vermittelte „Lebenswelt“. Sie übermittelt vom „kopräsenten“ Gegenüber eine reduzierte Informationsmenge, um synchrone Kommunikation, soziale Identität und damit Vertrauen zu ermöglichen. E-Mail, Video Conferencing, Voice Over IP, Voicemail, Chats, Newsgroups sowie Websites vermitteln Kommunikation auf der Basis des interpersonalen Vertrauens, obgleich sie die direkte Kopräsenz der Kommunikationspartner ersetzen und den damit verbunden Informationsreichtum simulieren bzw. stark mindern. Wie sich Vertrauen trotz dieser verhältnismäßig niedrigen Informationsmenge aufbauen kann, zeigen folgende Überlegungen.
Vertrauen gehört zwar zu den Strategien, im Zustand unsicherer oder mehrdeutigerer Information zu handeln, trotzdem bleibt es selbst auf Ausgangsinformationen angewiesen. Zu vermuten wäre, dass interpersonales Vertrauen in Abhängigkeit der verfügbaren Informationsmenge eines interaktiven Medium ausgebildet wird. In diesem Zusammenhang der Informationsmenge gibt die Definition der „Information Richness“ eine Orientierung:
“Information richness is defined as the ability of information to change understanding within a time interval. Communication transactions that can overcome different frames of reference or clarify ambiguous issues to change understanding in a timely manner are considered rich. Communications that require a long time to enable understanding or that cannot overcome different perspectives are lower in richness. /…/ Communication media vary in the capacity to process rich information. /…/ In order of decreasing richness, the media classifications are (1) face-to-face, (2) telephone, (3) personal documents such as letters or memos, (4) impersonal written documents, and (5) numeric documents. /.../ Media of low richness process fewer cues and restrict feedback, and are less appropriate for resolving equivocal issues. However, an important point is that media of low richness are effective for processing well understood messages and standard data.” (Daft & Lengel 1986, 560)
Neben dem Verstehen eine Mitteilung beeinflusst „Information Richness“ die interpersonale Vertrauensbildung. Greenspann et. al. zeigten in ihrer Studie über Interpersonal Trust, dass synchrone Kommunikation per Telefon deutlich zügiger Vertrauensbildungen unterstützt als asynchrone Kommunikation per Email. Des weiteren katalysierten die Medien, die die menschliche Stimme übertrugen, deutlich zügiger interpersonales Vertrauen, als diejenigen Medien, die ausschließlich visuell basierte Informationen anboten (vgl. Greenspann 2000, 251).
Information Richness eines Mediums hat auf interpersonales Vertrauen unterschiedliche Auswirkungen. Vermutlich beschleunigt Information Richness interpersonales Vertrauen zwischen zwei unbekannten Personen. Denn je mehrdeutiger oder schwieriger eine mitzuteilende Nachricht ist, desto dringlicher wird Vertrauen benötigt, um die Komplexität der Kommunikation mittels eines informationsreichen Mediums zu reduzieren und handlungsbereit zu werden. Vor dem Hintergrund dieser Hypothese ließe sich erklären, dass Manager eine informationsreiche Kommunikationssituation (Face-To-Face) vorziehen, um komplexe Nachrichten mitzuteilen und Unsicherheiten zu mindern (vgl. Daft & Lengel 1986, 560). Ein Hinweis für die beschleunigte Vertrauensbildung ist es sicher auch, dass innerhalb informationsreicher, synchroner Medien permanent kontrollierbar ist, dass die Fortsetzung des Vertrauens gerechtfertig ist. Asynchrone Medien erhöhen indessen das Risiko, dass vertrauensweckende Zeichen einfacher manipulierbar sind, um Vertrauen zu missbrauchen. Die Information Richness des Mediums sagt daher etwas darüber aus, wie hoch das temporale Schwierigkeitsniveau für Individuen ist, um vertrauenserweckende Zeichen zu simulieren oder zu manipulieren. Information Richness kann keinen Anhaltspunkt dafür geben, welche kommunikativen Zeichen vorhanden sein müssen, weil sie nicht den sozialen Handlungsbezug aufgreift, den die sich vertrauenden Interaktionspartner eingehen.
Obwohl die potentiell mögliche Temporalität des Mediums interpersonale Vertrauensbildung beeinflusst, ist es hinsichtlich der Kommunikation im Internet maßgeblich, auf vertrauensweckende Zeichen der sozialen Interaktionsbeziehung zu schauen. Die auf interpersonales Vertrauen aufbauende Kommunikation vollzieht sich in multimedialen Kommunikationstechniken vorrangig per Email, Voicemail oder rein privaten Homepages. Zu den Anhaltspunkten für die Vertrauenswürdigkeit einer Email oder Homepage gilt beispielsweise die Beherrschung der Technik. Diese Technikbeherrschung wird um so wichtiger, je deutlicher handlungsrelevantes Vertrauen hinsichtlich einer technischen Information erwiesen werden soll. Handelt es sich um eine politische oder vielleicht literarische Information, dann minimiert Technikbeherrschung selten das Vertrauen. Eher im Gegenteil erwecken politische Anliegen einer NGO im World Wide Web eher Mißtrauen, je professioneller sie ihr Marketing betreiben. Demgegenüber erzielt die professionelle Websitegestaltung der Markenartikelhersteller eher gestärktes Kundenvertrauen, weil in diesem Fall der Kauf des Markenimage und weniger der Nutzen der Ware angestrebt wird. In der Regel bemüht sich Webdesign, das Vertrauen der Akteure zu erlangen, indem es Vertrautheit oder Vertrauenswürdigkeit mittels eines sozial indizierenden Zeichen- und Stilmilieus mitteilt (vgl. Karvonen & Parkkinen 2001; Cheskin Research 1999).
In multimedialen Systemen, so hoch ihre Information Richness auch sei, sind es die sozial indizierenden Zeichen, die auf die Vertrauensbereitschaft eine Auswirkung haben. Insbesondere Fehler oder eine gewisse Unbeholfenheiten können beispielsweise innerhalb eines Kontextes der politischen oder privaten Kommunikation ein Vertrauen motivieren, das auf die inhaltliche Kompetenz des Mitteilenden zielt. Information Richness selbst befördert interpersonales Vertrauen, wenn sie die Möglichkeit des Kommunikationsfehlers erhöht. Man kann dies auf die folgende Formel bringen: Je höher die Fehlerwahrscheinlichkeit interpersonaler Kommunikation innerhalb eine stilistischen Kontextes ist, desto zügiger entwickelt sich Vertrauen. Beispielsweise kann ein Akteur sich in seiner Email mit „Prof. Dr.“ titulieren, wird dann aber selten Vertrauen erlangen, sobald er in der Hacker-Szene einen Diskussionsbeitrag leistet, weil man sich dort lieber „pipsmaus“ oder „jaguarxj“ nennt. Es ist hier einerseits der weitgehend emotionale Beziehungsaspekt und andererseits der Inhaltsaspekt der Kommunikation mit dem sich Vertrauen emotional oder rational ausbildet. Rational ist es sicher nicht, sich pipsmaus zu nennen, aber emotional kann ein solcher Name im richtigen Kontext ad hoc einen hohen Vertrauenswert genießen. Spontan, emotional orientiertes Vertrauen kürzt den Ermittlungsprozess ab, setzt aber andererseits meist eine Interessenidentität mit der informationsgebenden Person, der jemand vertraut, voraus.
Für das Vertrauen zwischen zwei Personen bieten zeichenhafte Implikationen eine grundlegende Basis. Information Richness beschreibt dann die mediale Bandbreite, auf der die Zeichen sowie Kontexte jeweiliger Kommunikation übertragen werden. Zu solchen vertrauenserweckenden Zeichen gehört z.B. Sprachstil, Werthaltung, Kontext und der Inhalt der Information selbst etc. Schon der kontextsensible Einsatz von wenigen Symbolen oder Indizes bietet die Sicherheit bzw. Unsicherheit, die kommunikativen Auswirkung der informationsreichen Medien auszuhebeln.
Für die Bereitschaft zu interpersonalem Vertrauen in multimedialen Systeme sind folgende Kriterien von besonderer Relevanz:
- Stilistische Kontextsicherheit und Involvement des Mitteilenden
- Kommunikative Performanz des Mitteilenden
- Kommunikative Kompetenz des Adressaten
- Einhaltung des kommunikativen Beziehungs- und Inhaltsaspekts der beteiligten Personen
- Indizierende Rückkopplung, dass das Vertrauen weiterhin gerechtfertigt ist.
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Vertrauen lässt sich bei höherer Medienvielfalt und Information Richness schneller erzielen, da die Wahrscheinlichkeit der unentdeckten Täuschung und Lüge infolge der übermittelten Informationskomplexität abnimmt. Wie erklärt sich unter dieser Annahme, dass sich das Vertrauen in den Newsgroups bei niedrigem Informationsmenge auf verhältnismäßig hohem Niveau befindet?
3.2. Soziales Vertrauen in Socialware
Soziales Vertrauen nimmt Bezug auf eine Pluralität von Personen, die sich miteinander verbunden meinen oder fühlen (vgl. Sztompka 1999, 43). Beispielsweise vertrauen sich die Teilnehmer einer Mailingliste hinsichtlich sensibler Informationen, die sie austauschen und nicht weitergegeben werden wollen. Oder die Teilnehmer einer Mailingliste vertrauen sich darin, ein Problem einer Open Source Software in Teamarbeit zu lösen. Beide Beispiele rekurrieren darauf, dass sich eine Community gebildet hat, deren soziale Infrastruktur auf wechselseitigem Vertrauen beruht. Mit anderen Worten bieten die Community eine Socialware, die darauf basiert:
- zu wissen, wer etwas weiß
- sich in identischen Kontexten auszukennen
- sich mit der laufenden Diskussion zu identifiziert
- ihre Problemlösungskapazitäten abschätzen zu können (vgl. Hattori et. al. 1998, 330)
Innerhalb der Socialware verliert Information Richness vollständig ihre Wirkung, da sozial motivierte Beziehungen den Kommunikationsablauf stabil halten. Das Vertrauen innerhalb der Gruppe richtet sich beispielsweise darauf, ob weiterhin Wissen getauscht wird, die Moral der Netikette beachtet wird, ob Problemlösungskapazitäten bestehen oder ob die in der Kommunikation erworbene Reputation hoch genug ist, um weiter teilzunehmen. Für alle Formen des sozialen Vertrauens gilt, dass multimediale Systeme es selbst nur gering beeinflussen können, weil es auf den Sinnzusammenhang sozialer Handlungen ausgerichtet ist.
3.3. Warum ersetzt Vertrauen die Glaubwürdigkeit in der heutigen Kommunikationstechnologie?
Die globale Medienlandschaft hat sich mit den interaktiven Kommunikationsmedien grundlegend verändert. Interaktive Medien lassen sich im Gegensatz zu klassischen Push Medien - wie z.B. das Fernsehen - nicht nur passiv konsumieren, sondern sie sind der Ort an dem Individuen aktiv handeln. Diese Entwicklung haben Kommunikationswissenschaftler übersehen. Sie untersuchen bis heute Glaubwürdigkeit der interaktiven Medien auf eine Weise, wie seit Jahrzehnten klassische, unidirektionale Medien evaluiert wurden. Glaubwürdigkeitsforschung spielt für die klassischen, unidirektionalen Medien eine Rolle, sie kann aber den multimedialen Orten des interaktiven Handelns in keiner Weise Rechnung tragen. Wie begründet sich dies?
Kommunikationswissenschaftler evaluierten in zahlreichen Studien die Glaubwürdigkeit unidirektionaler Medien (vgl. Rössler 1999). Ihr Ausgangspunkt war meist ähnlich. Glaubwürdigkeit sei kein vorfindbarer Zustand des Kommunikators, sondern eine vom Rezipienten zugeschriebene oder attribuierte Eigenschaft (vgl. Schweiger 1998). Mit dem Attribut „Glaubwürdigkeit“ schätzen Mediennutzer anhand sogenannter CARS-Kriterien ein, bis zu welchen Graden sie die vom Kommunikator angebotenen Nachrichten als sinnvoll erachten. Zu den vier CARS-Kriterien gehören:
- Glaubwürdigkeit „credibility“: Bewertung des Autors hinsichtlich Bildung, Organisationszugehörigkeit und berufliche Position
- Genauigkeit „accuracy“: Mitteilung des Entstehungsdatums sowie der Versionshistorie der Quellen. Zielpublikum und Zweck der Veröffentlichung
- Vernünftigkeit „reasonableness“: Fairness in der Argumentation, eigene Voreingenommenheit prüfen, Schlüssigkeit und Widerspruchsfreiheit der Information
- Belege „support“ (vgl. Harris 1997)
Die Kriterien verdeutlichen, dass die Glaubwürdigkeit eines Sendeformats eine risikolose Einschätzung ist. Medienkonsum schließt keine unmittelbare Risikodisposition ein. Als Mediennutzer konsumieren wir beispielsweise unglaubwürdige Medienbeiträge, ohne dass wir uns in unserer Alltagspragmatik beeinträchtig fühlen. Eventuell ist es mitunter informativer und interessanter, glaubwürdige Medienbeiträge zu sehen. Doch die Einschätzung von Glaubwürdigkeit hat per se keine notwendige Handlungsrelevanz. Aufgrund der mangelnden Konsequenzen verunsichert es Rezipienten auch wenig, die Informationen der Medien zu konsumieren, denen sie eine mittlere oder gar geringe Glaubwürdigkeit zuschreiben. Eher im Gegenteil schützt die Einschätzung der Glaubwürdigkeit den Rezipienten davor, sich verunsichern zu lassen. Unterstellte Unglaubwürdigkeit schützt davor, weder den Beitrag für relevant zu halten noch handeln zu müssen.
Vertrauen beansprucht eine qualitativ andere soziale Bezugnahme als Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit drängt auf die Überzeugungskraft inhaltlichen Sinns. Vertrauen zielt darauf, unter unüberblickbaren Risikobedingungen individuelles Handeln zu ermöglichen. Vertrauende wägen also ab, bis zu welchen Graden ihr Handeln sinnvoll ist. Wahrheit, Überprüfbarkeit und Logik nehmen zuviel Zeit in Anspruch, um hinsichtlich des kontingenten Wissens der Gesellschaft ihren Orientierungswert zu behalten. Zwar lassen sich die Top 10 Kriterien der Informationsqualität benennen, aber kein Akteur in multimedialen Systemen hat Zeit sie abzuarbeiten. Aufgrund des Zeit- und Wissensmangels in Gesellschaften übernehmen deshalb z.B. einzelne Internetanbote eine informationsfilternde Funktion, die das Vertrauen der Akteure mit praktikablen Ratschlägen sowie Informationen gewinnen. Solche Portale, Newsgroups und Websites fungieren quasi als „Knowledge-Trust-Center“, indem sie relevante Information von irrelevanten unterscheiden. Mittels dieser Filterfunktion geben sie soziale Orientierung, welches die praktikabelste „Wahrheit“ sein könnte, um im Vertrauen auf den jeweiligen Vorschlag, eine Entscheidung des Anwenders zu unterstützen. Eine vergleichbare mediale Funktion wie das Internet konnten die klassischen Medien nur bedingt einnehmen. Nicht mehr Wahrheit oder Glaubwürdigkeit einer Information orientiert die Akteure, sondern das Vertrauen, dass sie ihrem Anbieter einer Handlungsorientierung schenken. Auch in Newsgroups und Mailinglisten gelten Privatpersonen als vertrauenswürdige Kompassnadeln im Konsumdschungel. Vertrauen in Socialware gehört deshalb zu den grundlegenden Ressourcen, um in multimedialen Systemen handlungsfähig bleiben zu können.
4. Perspektiven des Vertrauens in multimedialen und interaktiven Systemen
Bei Vertrauen handelt es sich nicht zuletzt um eine moralische Qualität der sozialen Bezugnahme (vgl. Köhl 2001, 114). Glaubwürdigkeit benannte lediglich eine Medienwirklichkeit, zu der die Konsumenten auf Distanz gehen konnten. Die Zeitung, das Fernsehen und das Radio berichten aus einer Welt, die selten im Alltag ihren konkreten Niederschlag fand. Vertrauen verdeutlicht, dass Akteure in eine für sie wirkliche, medial vermittelte „Lebenswelt“ einsteigen und dort ihre sozialen Räume handlungsrelevant gestalten. Socialware benennt somit die Erweiterung des alltäglichen Handelns unter der Prämisse multimedialer Räume. Information Richness beschreibt dann nur noch die mögliche Komplexität sozialen Handelns. Soll diese Medienorientierung unter dem Gesichtspunkt einer Verantwortungsethik beschrieben werden, ist zu erwarten, dass in der „E-Society“ eine moralische Wertverschiebung stattfindet, bei der Glaubwürdigkeit und Wahrheit durch Vertrauen als Orientierungsparameter ersetzt oder zumindest ergänzt wird. Socialware in multimedialen Systemen markiert den Beginn eines sich drastisch verändernden, sozialen Handels, das medialvermitteltes Vertrauen als Orientierungsweise nutzt.
5. Literaturverzeichnis
Bechter, F. (2001): Internet: Zen oder Zauberlehrling? Vom Vertrauen in und Vertrautheit mit neuen Medien, In: Schweer, M.K.W. Der Einfluss der Medien, Vertrauen und soziale Verantwortung, S. 125-144, Opladen, Leske + Buderich.
Cheskin Research (1999): Ecommerce Trust Study, A Joint Research Project by Cheskin Research and Studio Archetype/Sapient. 24.05.2002 http://www.sapient.com/cheskinDaft, R. L.; Lengel, R. H. (1986): "Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design," Management Science (32:5), pp. 554-571.
Funakoshi, K.; Kamei, K.; Yoshida, S.; Kuwabara, K. (2001): Incorporating Content-Based Collaborative Filtering in a Community Support System, in Yuan, S.-T. and Yokoo, M. eds., Intelligent Agents: Specification, Modeling, and Applications (PRIMA2001 Proceedings), LNAI 2132, pp.198-209, Springer-Verlag.
Greenspann, S.; Goldberg, D.; Weiner, D.; Basso, A. (2000): Interpersonal Trust and Common Ground in Electronically Mediated Communication, in: CSCW 2000, Computer Supported Cooperative Work, December 2-6. 2000, New York, ACM Order Department.
Reese, F. (2001): Vertrauen und eCommerce, Ideal Observer, 24.04.02 http://www.idealobserver.de/htdocs/vertrauen.html
http://www.idealobserver.de/docs/vertrauenimecommerce.pdf
Robert, H. (1997): Evaluating Internet Research Sources, Version Date: November 17, 1997, 31.02.2002, http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm
Rössler, P.; Wirth, W. (Hrsg.) (1999): Glaubwürdigkeit im Internet: Fragestellungen, Modelle, empirische Befunde, München: R. Fischer.
Hattori, F., Ohguro, T., Yokoo, M., Matsubara, S., Yoshida, S. (1998): Supporting network communities with multiagent systems, in Ishida, T., editor, Community Computing and Support Systems: Social Interaction in Networked Communities, LNCS 1519, pp. 330 - 341, Springer-Verlag.
Karvonen, K.; Parkkinen, J. (2001): Signs of Trust, in Proceedings of the 9th International Conference on HCI (HCII2001), August 5-10, 2001, New Orleans, LA, USA, 2001.
Luhmann, N. (2000): Vertrauen, ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, 4. Aufl. Stuttgart: Lucius und Lucius.
Maletzke, G. (1998): Kommunikationswissenschaft im Überblick: Grundlagen, Probleme, Perspektiven, Opladen: Westdeutscher Verlag.
Misztal, B. A. (1996): Trust in modern societies: the search for the bases of social order, Cambridge: Polity Presse.
Köhl, H. (2001): Vertrauen als zentraler Moralbegriff? In: Hartmann, Martin; Offe, Claus (Hrsg): Vertrauen, Die Grundlage des sozialen Zusammenhalts, Frankfurt/New York, Campus Verlag.
Schweiger, W. (1998): Wer glaubt dem World Wide Web“ in: Rösler, P.: Online-Kommunikation Opladen: Westdeutscher Verlag.
Sztompka, P. (1999): Trust, A Sociological Theory, Cambridge: Cambridge University Press.